Wandern auf dem Erlanger Bierberg
9.8.2011, 16:57 Uhr
Na da, da lugt doch ein roter Turm aus den Bäumen hervor. Irrtum: Dies ist nur der Wasserturm, 1905 in historisierendem, mittelalterlich empfundenem Stil errichtet. Tatsächlich hat es eine Burg auf diesem Berg nie gegeben. Dafür hat der Erlanger Berg mit dem Nürnberger etwas anderes gemeinsam: Wie dieser ist auch er mit Bierkellern durchlöchert, die sich 70 bis 100 Meter tief ins Gestein erstrecken. Weshalb man ihn mit Fug und Recht als Bierberg titulieren darf. Schließlich versorgten im 19. Jahrhundert allein in Erlangen 18 Brauereien das durstige Volk und die halbe Welt. Was allein schon den Berg zu einem fränkischen Weltwunder befördert.
Seine große Zeit hat der Berg, wenn er jedes Jahr zu Pfingsten für zwölf Tage zur Kirchweih ruft. Dann bewegt sich alles, was Beine hat, in seine Gärten und füllt sich ab: Studenten, Professoren, Siemensianer, brave Bürger, einfache Leute, wilde Gestalten. Das Bier macht sie alle gleich. Doch seinen wahren Zauber entfaltet der Berg außerhalb der Kirchweih. Es ist kaum zu glauben, wie ruhig und verwunschen er sich dann erweist.
Der Wanderer beginnt seine Runde an den Bierkellern, wo die Bäume mannshoch mit Brettergürteln umwickelt sind, um die Rinde vor vorbeischrammenden Lieferwagen zu schützen. Ein Schild weist den Pfad zum Skulpturengarten und zum Platenhäuschen. Nach wenigen Metern schon begrüßt den Bergsteiger ein Ei auf zwei dürren Beinen und mit langen Armen. Weitere ovale Gestalten gesellen sich dazu. So ähnlich hat sich H. G. Wells seine Marsmenschen in „Krieg der Welten“ vorgestellt. Tatsächlich handelt es sich um Skulpturen des Bildhauers Heinrich Kirchner (1902–84), der sich im Burgberggarten nach Herzenslust austoben durfte.
Die ovale Form ist keine Lust und Laune, sondern Absicht. Das Ei symbolisiert die Hoffnung, die die Menschen nach dem überstandenen Krieg erfüllte. Tatsächlich kann sich der Besucher eines Gefühls von Beschwingtheit kaum entziehen. Ein hoffnungsloser Trauerkloß, wer da nicht lächeln kann. Große Statuen auf der Wiese wechseln sich immer wieder ab mit Figürchen im Schatten der Büsche oder korrespondieren mit den Hermen hellenischer Heroen. Der eine schaut aus wie Perikles, der andere könnte ein verwitterter Sokrates sein. Nun erreichen wir die Burgbergstraße.
Still ist es hier. Kein Auto rührt sich, von Fußgängern nichts zu sehen, selbst spielende Kinder haben schier ihre Zunge verschluckt. Hier herrscht die diskrete Stille der Besserverdienenden. Direkt neidisch könnte man werden ob der Villen. „Ihr wandelt droben im Licht, auf weichem Boden, selige Genien“, dichtete schon Hölderlin. Freilich: so mancher Bergbesucher, der zuviel des Nektars aus Hopfen und Malz genoss, musste seine gastronomischen Genüsse wieder von sich geben, oben- wie untenrum. Solch weichen Boden am frühen Morgen auf heimischer Schwelle aufzufeudeln ist kein Vergnügen. So sorgen die Götter für ausgleichende Gerechtigkeit.
Ohne den Wegweiser würden wir das Platenhäuschen gar nicht finden, dermaßen versteckt liegt es an der Nordseite des Bergs. Da ist es ja schon: kaum größer als ein Geräteschuppen, offen an jedem ersten Sonntag im Monat von 11–17 Uhr. Da drin also hatte im Sommer 1824 der Dichter August Graf von Platen-Hallermünde an seinen Ghaselen gefeilt und von wahrer Männerliebe geträumt. „Platz ist in der kleinsten Hütte für ein frisch verliebtes Paar“, glaubte Schiller. Am Platenhäuschen kann man den Zusammenprall von Idealismus und Realität studieren. Die Dimensionen des Platenhäuschens reichen gerade für einen Single-Haushalt ohne höhere Ansprüche.
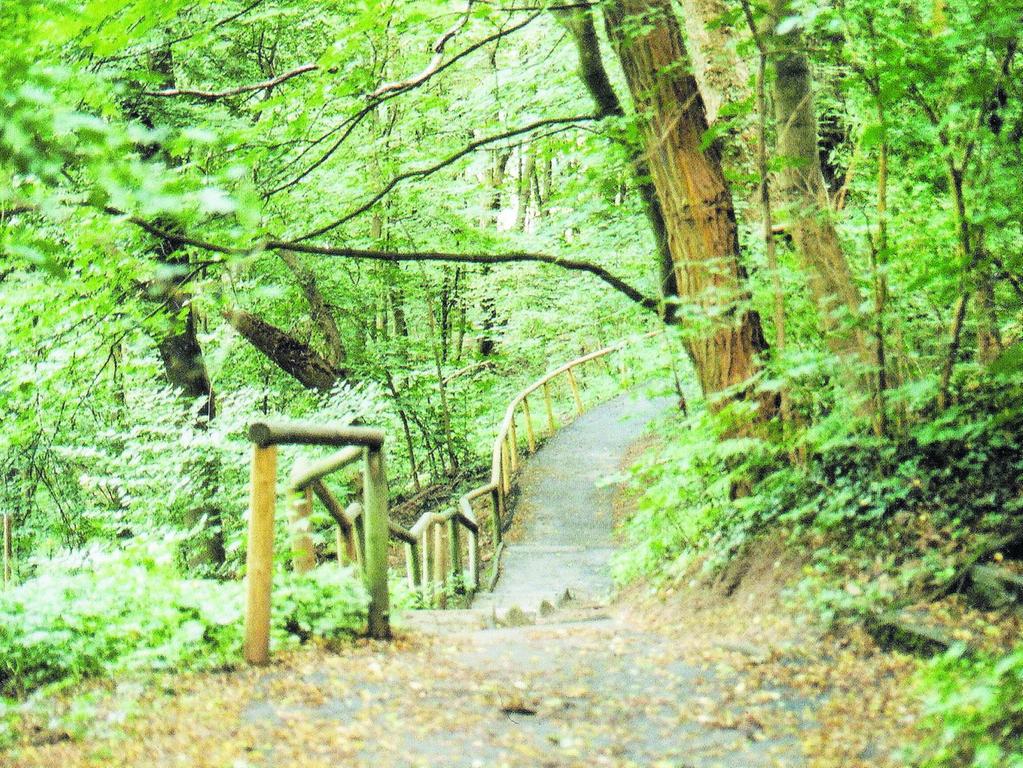
Wir gelangen westwärts am Wasserturm vorbei zur Böttiger Promenade. Der Wald verdichtet sich zum Urwald, Schilder warnen vor brechenden Ästen und empfehlen, die Wege nicht zu verlassen. Eine tolle Mischung aus gepflegten und versunkenen Gärten sowie wucherndem Dschungel erwartet den Flaneur. Linkerhand windet sich der Weg zum Schneckenbergla hinauf, dem Lieblingsplatz des Orientalisten Friedrich Rückert. Rechterhand geht es zur Solitude, wo aus dem Höhlenmaul des ältesten bayerischen Eisenbahntunnels (1844) fauchend ein Zug entweicht. Unvermutet erheben sich Grabsteine mitten im Wald. Dies ist der israelitische Friedhof aus dem Jahr 1891.
Gehen wir den Weg abwärts und umrunden wir den Fuß des Berges, stehen wir vor einem Denkmal der menschlichen Torheit. Eine Inschrift kündet vom Ludwig-Donau-Main-Kanal, obendrüber reichen sich die Allegorien von Main und Donau die Hand, flankiert von den zweckerten Mädels Wirtschaft (mit Füllhorn) und Handel (mit Winkelmaß).
Ja und wo isser, der Kanal? Weg, zugeschüttet, verbetoniert. Wo einst die Enten dümpelten, sausen die Blechkisten wahnsinniger Raser. Nur wenige Meter hinter dem Kanaldenkmal, in der Tiefe des Berges, rumort die Eisenbahn, die dem Kanal wirtschaftlich das Wasser abgegraben hatte. Schon ein Jahr vor der Kanalvollendung (1845) erstreckte sich hier die Bahntrasse. Dabei hätte es des Tunnels gar nicht bedurft. Aber entweder bestand König LudwigI. auf seiner 306 Meter langen Röhre, oder die Ingenieure wollten ihr Können beweisen – jedenfalls, der Tunnel musste her, auch wenn er überflüssig war. Was heute für viele Menschen Stuttgart21 ist, war damals Erlangen19. Immerhin, der Tunnel erfreut mit Kunst am Bau das Herze. An seiner Südseite halten zwei bayerische Löwen Wacht am Eingang, an der Nordseite kauern zwei Sphingen und lächeln über des Menschen Irrwitz.
Wir aber haben unsere Runde vollendet und setzen uns gedankenschwer in einen Biergarten, labend am schäumenden Quell.
Keine Kommentare
Um selbst einen Kommentar abgeben zu können, müssen Sie sich einloggen oder sich vorher registrieren.
0/1000 Zeichen

