Welche Chancen Germanisten haben
31.12.2008, 00:00 Uhr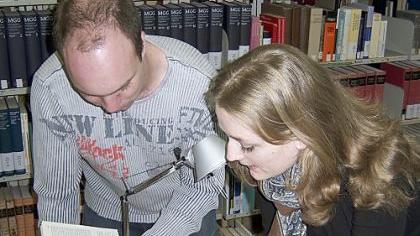
«Germanisten arbeiten vorwiegend in unspezifischen Berufsfeldern», sagt Studienberater Wolfgang Henning von der Uni Erlangen. Also in Jobs, die nicht unbedingt ein Germanistik-Studium voraussetzten. «Viel wichtiger ist, dass man überhaupt studiert hat», sagt Henning. Der Geisteswissenschaftler zeichne sich nämlich durch bestimmte Kenntnisse und Schlüsselqualifikationen aus – wie recherchieren, analysieren, formulieren.
Einige spezifische Berufe gibt es auch für Germanisten. «Sie können etwa für Politiker Reden schreiben, an der Uni oder anderen Einrichtungen forschen, Lektor in einem Verlag werden oder Texte ins Deutsche übersetzen», sagt Henning, «es gibt viele Möglichkeiten.» Durchstöbert man die Internet-Jobbörse einer großen deutschen Tageszeitung unter dem Schlagwort «Germanist», erhält man 35 Treffer. Gut die Hälfte davon sind universitäre Stellenangebote. Auch die Uni Erlangen-Nürnberg bietet eine Professur für Germanistische Linguistik mit dem Schwerpunkt Deutsch als Fremdsprache an.
Stelle als technischer Redakteur
Aber was hat die freie Wirtschaft zu bieten? Ein Germanist mit technisch-naturwissenschaftlicher Ausbildung könnte in Berlin technischer Redakteur werden und in Frankfurt am Main sucht man Mitarbeiter für die Unternehmenskommunikation. Außerdem kann sich der Germanist in München zum PR-Redakteur ausbilden lassen oder in Weinstadt ein Volontariat bei einem Online-Magazin absolvieren. Ansonsten gibt es nur Nebenjob-Angebote für Studenten.
Milena Bäcker braucht keine Stellenanzeigen. Sie weiß schon ganz genau, was sie nach ihrem Studium der Germanistik und Anglistik machen will. Ihre Lieblingsdisziplin hat die 21-Jährige in der Linguistik gefunden. Hier behandelt sie Bereiche wie kognitive Linguistik, bei der die mentalen Prozesse beim Erwerb, der Verwendung und dem Verlust von Sprache untersucht werden.
Aus diesem Interesse entwickelte sich der Wunsch, nach der Uni eine Ausbildung zur Logopädin zu absolvieren. Das Studium war für die 21-Jährige bei dieser Entscheidung richtungsweisend. «Ich habe gemerkt, dass mich Germanistik in Verbindung mit Pädagogik und Psychologie sehr interessiert», sagt die gebürtige Wolfsburgerin. Durch das Studium könne sie nun auch einschätzen, was bei der Ausbildung auf sie zukomme.
Der Werdegang des 27-jährigen Roland Weber verlief genau anders herum: Er absolvierte zunächst eine Ausbildung zum Sporttherapeuten, entschloss sich dann aber, Theater- und Medienwissenschaft zu studieren. Als zweites Hauptfach wählte er Germanistik.
Während seiner Zwischenprüfung verschoben sich dann die Interessen: «Als ich mich sehr intensiv mit Germanistik auseinandergesetzt hatte, habe ich gemerkt, dass ich lieber im germanistischen als im Theater-Bereich arbeiten würde», erzählt der gebürtige Schwäbisch-Haller. Einen genauen Berufswunsch hat er allerdings noch nicht. «Ich möchte gerne in einem Beruf arbeiten, in dem ich mit Sprachstörungen oder Sprachentwicklung zu tun habe», sagt Weber.
Mit praxisbezogenen Angeboten versucht das Departement Germanistik der Uni Erlangen ihre Studenten auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten. So sollen beispielsweise journalistische Fähigkeiten, EDV-gestütze Literatur- und Sprachwissenschaft und literarisches Übersetzen vermittelt werden.
Durch die Einführung des Bachelor-Studiengangs ist der praxisbezogene Anteil des Lehrplans deutlich gestiegen. «Die Chancen für Germanisten auf dem Arbeitsmarkt werden dadurch klar verbessert», sagt Christine Lubkoll, Professorin für Neuere Deutsche Literaturgeschichte. Allerdings empfehle es sich, aufgrund der zahlreichen Germanistik-Studenten, nach dem Bachelor noch einen Master-Studiengang anzuschließen.
Langer Weg zum Leiter Technikpresse
Thomas Wenzel hat schon lange in keiner Vorlesung mehr gesessen. Der 39-Jährige studierte in Erlangen und Rom germanistische Linguistik, Neuere Deutsche Literaturgeschichte, Italoromanistik und Geschichte. Heute ist er Pressesprecher bei einem Automobilzuliefererkonzern mit Sitz in Friedrichshafen und Leiter der Technikpresse und Produktkommunikation. Der Weg dorthin war lang. «Direkt nach dem Studium habe ich als freier Mitarbeiter bei Tageszeitungen gearbeitet, dann im PR-Bereich, dazwischen an der Uni und im Weiterbildungsbereich und schließlich als Hochschulpressesprecher», erzählt Wenzel.
Die Chancen für Germanisten auf dem Arbeitsmarkt sieht er eher positiv. «Wenn man in gewissem Maße flexibel ist, ist es nicht schwer, Fuß zu fassen», sagt Wenzel. Vor allem dürfe man nicht scheu sein, den kulturellen Bereich zu verlassen. «Man muss offen sein für Neues. Auch für studienferne Themen, wie beispielsweise Technik», sagt Wenzel.
Keine Kommentare
Um selbst einen Kommentar abgeben zu können, müssen Sie sich einloggen oder sich vorher registrieren.
0/1000 Zeichen

