Extreme Monate: So war die erste Corona-Welle im Fürther Klinikum
16.06.2020, 06:00 Uhr
Dr. Manfred Wagner (51), Mitglied der Klinikumsleitung und Pandemiebeauftragter, und Prof. Dr. Harald Dormann (50), Leiter der Zentralen Notaufnahme, gehören zum Krisenstab des Fürther Klinikums, der über zehn Wochen hinweg täglich zusammenkam. Inzwischen können sie durchatmen: Der vorerst letzte Covid-19-Patient wurde vergangene Woche entlassen.
Das Fürther Klinikum war lange das Krankenhaus mit den meisten Covid-19-Patienten im Großraum. Gleichzeitig hatten die Prognosen aber noch Schlimmeres befürchten lassen. Wie hat sich’s angefühlt, als Sie mitten drin steckten?
Dormann: Für mich persönlich war es eine belastende Zeit. Es ist körperlich anstrengend, mit der FFP2-Maske zu arbeiten – da dringt keine Luft von außen ein und nach der Schicht ist man so erschöpft, als hätte man eine Bergtour gemacht. Dazu kam die Verantwortung, die man gespürt hat. Man wusste nie, was noch kommt. Auf der anderen Seite haben sich die Zahlen Gott sei Dank in Grenzen gehalten. Momentan geht man davon aus, dass 1 Prozent der Bevölkerung Corona durchgemacht hat – wenn wir von 1 auf 2 Prozent gekommen wären, dann wäre es unerträglich geworden. Das klingt unglaublich, weil wir gewohnt sind, linear zu denken und nicht exponentiell, wie es bei Corona nötig ist.
Wagner: Beruflich war es die größte Herausforderung meines Lebens. Ich hatte immensen Respekt vor den prognostizierten Zahlen. Mit 60 beatmeten Patienten gleichzeitig mussten wir rechnen. Darauf haben wir uns vorbereitet. In diesen Nächten habʼ ich ganz schlecht geschlafen. Aber ich habʼ auch eine unheimliche Energie gespürt, bei mir und im Klinikum, die ich so nicht für möglich gehalten hatte. Das war eine schöne Erfahrung.
Statt 60 waren es auf dem Höhepunkt der Welle zwölf Patienten, die beatmet werden mussten.
Wagner: Ich bin heilfroh, dass es nicht anders kam. Ich hatte Angst davor, dass wir hier entscheiden müssen, wer ans Beatmungsgerät kommt und wer nicht. Fordernd und intensiv war es trotzdem. Ich hatte jetzt erstmals eine Woche frei, zuvor hatte ich seit 8. März nur an einem einzigen Tag nicht gearbeitet: an meinem Geburtstag.

Dormann: Wir im Krisenstab waren rund um die Uhr erreichbar. Die Befunde kamen auch nachts rein.
Wagner: Unser Leben beschleunigte sich immens, während es sich für die Umwelt drastisch entschleunigte. Und man muss sich klar machen, dass man ja nie wusste: Wie schlimm wird’s noch?
Dormann: Auf den Normalstationen hatten wir zugleich mehr als 60 Covid-19-Patienten, das ist auch eine ganz andere Belastung für das Krankenhaus. Die Mitarbeiter können nicht einfach zu anderen Patienten wechseln.
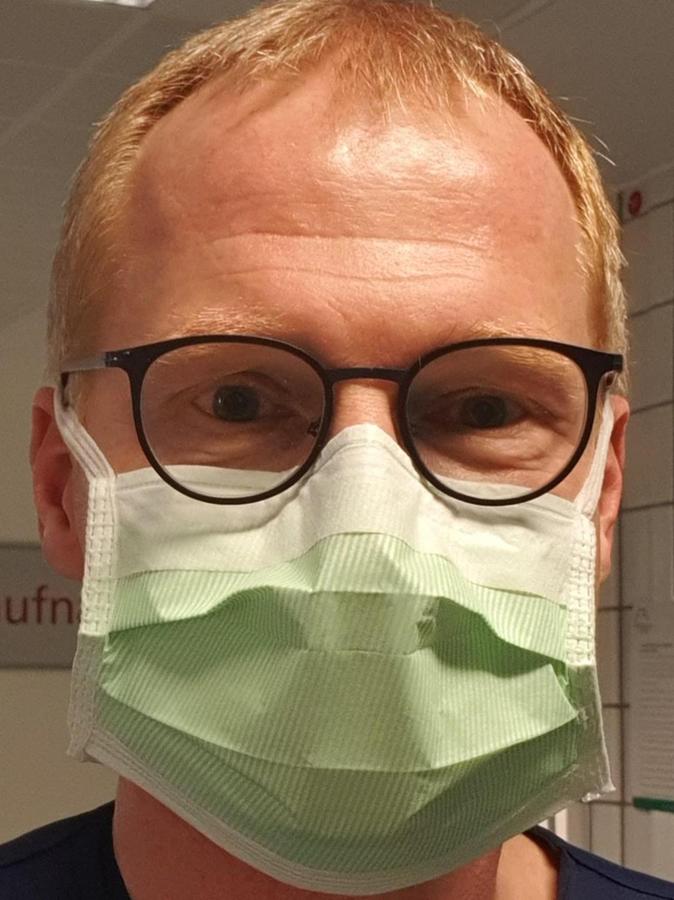
Wie geht es Ihnen damit, dass manche Menschen nicht glauben, dass Corona sonderlich gefährlich ist?
Dormann: Für meine Familie war das bedrückender als für mich, glaube ich. Wenn jemand zu ihnen sagte: Das ist doch alles Humbug. Wer nicht im Krankenhaus arbeitet, erlebt es ganz anders. Wir sehen die hohe Sterblichkeit. Es ist seelisch enorm belastend, wenn sich der Zustand eines Patienten innerhalb kurzer Zeit massiv verschlechtert. Unerträglich ist es, wenn man hört, die Patienten wären ja eh bald gestorben. So darf man nicht denken in dieser Gesellschaft. 70-Jährige werden heute 90.
Ihr ältester Covid-19-Patient war 101 Jahre alt . . .
Dormann: Und er überstand es. Das Alter ist kein Grund, nicht ins Krankenhaus zu gehen. Es gibt Ältere, denen wir sehr gut helfen können.
Was sagen Sie Leuten, die klagen: Bei der Grippe machen Sie nicht so einen Wirbel?
Dormann: Die Grippe hat eine deutlich geringere Sterblichkeit, wenn Patienten stationär behandelt werden müssen. Man muss absolut ablehnen, das gleichzusetzen.
Warum musste das Fürther Klinikum so viele Covid-19-Fälle versorgen? Mehr als 170 Patienten waren es bisher.
Dormann: Stadt und Landkreis Fürth waren durch die Ausbrüche in den Pflegeheimen relativ stark betroffen. In Erlangen ist die Bevölkerung im Schnitt jünger, und in Nürnberg verteilten sich die Fälle auf verschiedene Krankenhäuser. Wir waren mit den benachbarten Kliniken aber in Kontakt. Zum Glück hat auch die Zusammenarbeit mit Rettungsdiensten, dem Katastrophenschutz, den Koordinationsgruppen von Stadt und Landkreis sehr gut funktioniert.
Wagner: Und wir sind unheimlich dankbar dafür, dass die Mitarbeiter das so gut mitgetragen haben.
Trotz der Furcht, sich womöglich anzustecken . . .
Dormann: Ja, man sagt ihnen quasi: Du musst einen Patienten versorgen, über dessen Erkrankung wir nichts wissen. Die Beschäftigten haben natürlich die Sorge, das private Umfeld anzustecken. Deswegen müssen sie darauf vertrauen können, dass das Schutzkonzept funktioniert.
Sie haben enorm viel Energie in neue Wege der Kommunikation gesteckt, in tägliche Podcasts und Social Media. War das getrieben von der Sorge, die Mitarbeiter könnten nicht mitziehen?
Wagner: Nicht nur. Mit 2600 Beschäftigten ist das Krankenhaus ein Tanker. Um da agil zu bleiben, was in der Lage absolut notwendig war, muss man alle mitnehmen und alle informiert halten. Stationsbesprechungen waren nicht mehr möglich wie sonst, und gleichzeitig war es wichtiger denn je, dass jeder auf dem neuesten Stand war. Wir waren überzeugt: Von der Küche bis zur Pforte muss jeder die Situation verstehen und wissen, warum wir gerade welche Maßnahmen umsetzen.
Trotz der Pandemiepläne, die in Schubladen lagen: Corona schien alle unvorbereitet zu treffen. Was war fürs Krankenhaus die größte Herausforderung?
Dormann: Wir hatten es mit einem Virus zu tun, mit dem alle noch nicht umzugehen wussten. Empfehlungen zur Therapie und zur Organisation wurden oft geändert. Wir haben versucht, eine eigene Meinung zu entwickeln, und stellten unsere Strategie (bei welchen Symptomen getestet wird und wer welche Schutzausrüstung trägt, Anm. der Redaktion) einige Male schon um, noch bevor das Robert-Koch-Institut entsprechende Vorgaben machte. Weil wir als Krankenhaus so stark betroffen waren, mussten wir besonders scharfe Sicherheitsmaßnahmen treffen.
Wagner: Im Krisenstab sind verschiedene Fachrichtungen vertreten, jeder hat seine Fühler ausgestreckt und seine Expertise eingebracht. Ich glaube, das hat uns geschützt. Wir haben über 170 Covid-19-Patienten behandelt – und es gab auf der Intensivstation und in der Notaufnahme keinen Mitarbeiter, der positiv aufs Coronavirus getestet wurde. Seit Anfang April, da wurde es besser mit den Lieferengpässen, sind FFP2-Masken beispielsweise generell für alle Beschäftigten im direkten Patientenkontakt vorgeschrieben – auch für Reinigungskräfte. Da waren wir Vorreiter in der Metropolregion.
Wie gravierend waren die Engpässe?
Dormann: Es war schlimm, weil wir nicht wussten, wie lang das so weitergehen würde. Wenn wir Masken bestellten, konnte es tags darauf heißen: Sie wurden in die USA umgeleitet. Die bezahlten ja jeden Preis. Anfangs mussten wir auch noch drei bis fünf Tage auf Testergebnisse warten – umso wichtiger wiederum war der Schutz.
Alle Mitarbeiter des Fürther Klinikums werden auf Corona getestet
Sie haben auch Erfahrungen aus Italien und China genutzt.
Wagner: Wir haben italienische Kollegen im Haus, die haben nachts angerufen, weil sie etwa gerade mit dem Papa telefoniert hatten, und sagten: Die stapeln gerade die Särge in den Kirchen in Bergamo, weil sie keine Kühlmöglichkeiten haben. Wir waren in Kontakt mit den Krankenhäusern in München-Schwabing, wo die Webasto-Fälle behandelt wurden, und in Potsdam, um viel Wissen zu bekommen. Frühere Mitarbeiter, die heute in Italien arbeiten, haben uns von ihren Strategien berichtet und Vorträge geschickt. Und es gab internationale Webinare mit Medizinern aus China, den USA, Frankreich und Italien.
Dormann: Die Publikationen aber waren freilich widersprüchlich, so wie ja auch die Virologen unterschiedlicher Meinung waren und sind. Da muss man dann eine Strategie fürs Haus finden.
Was haben Sie über das Virus gelernt?
Dormann: Erst dachte man, dass es sich um eine Lungenkrankheit handelt. Jetzt weiß man, dass das Virus nicht nur die Atemwege befällt. Es ist eine Erkrankung des ganzen Körpers, die zu Multiorganversagen, Harnwegsinfektionen, Blutgerinnseln und Infarkten führen kann. Ein großes Problem ist, dass man eben symptomfrei sein und andere anstecken kann, die dann möglicherweise schwer erkranken. Anfangs gingen Experten noch davon aus, dass jemand wenig Viruslast hat, wenn er keine Symptome zeigt. Das hat sich auch verändert.
Klinikum Fürth stellt sich auf einen neuen Alltag mit Corona ein
Wie gut haben die Bürger mitgespielt?
Dormann: Die Bevölkerung hat sich extrem souverän verhalten, die ist echt cool geblieben, trotz der Verunsicherung. Die aufgeklärte, informierte Gesellschaft hat wesentlich dazu beigetragen, dass der Lockdown eingehalten wurde.
Wagner: Eine wichtige Rolle spielen auch die Medien, die das differenziert darstellen.
Wie stehen Sie zu den Lockerungen?
Wagner: Ich kann sowohl die Menschen verstehen, die sagen, es braucht mehr Lockerungen, als auch die, die davor warnen. Wichtig ist, dass wir uns von den Scharfmachern nicht leiten lassen.
Dormann: Ich habe unheimlich viel Respekt für die Politik, die Entscheidungen treffen muss und dabei die Gesellschaft nicht verlieren darf. Sollte eine zweite Welle kommen, werden wir mit mehr Wissen und Routine reingehen.
Information für Patienten: Das Klinikum Fürth stellt sich zurzeit auf eine "neue Normalität" ein, in der es immer wieder Covid-19-Fälle geben wird. Zum Schutzkonzept gehört, dass jeder Patient, der neu aufgenommen wird, aufs Coronavirus getestet wird. Auch alle Mitarbeiter werden nach und nach getestet. Es sei fatal, wenn Menschen aus Angst vor einer Ansteckung mit Corona nicht in die Notaufnahme gehen, sagt Prof. Dr. Dormann. Sein Appell: "Bitte kommt frühzeitig!" Das Risiko, sich im Krankenhaus anzustecken, sei sehr gering.
Keine Kommentare
Um selbst einen Kommentar abgeben zu können, müssen Sie sich einloggen oder sich vorher registrieren.
0/1000 Zeichen




